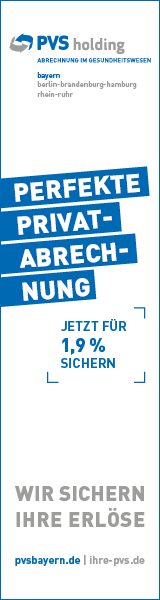Den Strukturwandel zukunftsfähig gestalten
 Dr. Gerald Quitterer
Dr. Gerald Quitterer
Die Begriffe Umbau, Transformation und Disruption ziehen sich derzeit durch alle Bereiche unseres Staatswesens und der Gesellschaft – in Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Kultur und Medien. Der Wandel macht vor keiner Branche halt und so verändert die Digitalisierung auch das Gesundheitswesen. Dieser betrifft Kostenträger und Leistungserbringer gleichermaßen, vor allem aber die Patientinnen und Patienten, die durch digitale Lösungen eine aktivere Rolle als „souveräne Kundinnen und Kunden“ einnehmen sollen. Das Krankenhaus 4.0 setzt auf digitale Patientenakten, Start-ups und etablierte Unternehmen, bauen an Apps und Lösungen für ein innovatives Gesundheitssystem. Elektronisches Rezept (eRezept), digitale Krankschreibung (eAU) und natürlich die elektronische Patientenakte (ePA) machen erst den Anfang. Doch die wahre Disruption im Gesundheitswesen findet meiner Meinung nach erst dann statt, wenn neue Technologien KI-vermittelt in die Gesundheitsversorgung unmittelbar an Patientinnen und Patienten eingreifen. Digitale Bilderkennung in der Radiologie ist zum Standard geworden, KI-Chatbots kommunizieren mit Patientinnen und Patienten, unterstützen bei der Anamneseerhebung und Erstellung einer Differenzialdiagnose und es dürfte eine Frage der Zeit sein, bis sie in selbstständige Entscheidungsprozesse Einzug halten oder sogar Behandlungsempfehlungen geben. Entfällt dann der Besuch in einer Arztpraxis? Jedenfalls lassen sich Überlegungen in diese Richtung finden: So stellt sich die Techniker Krankenkasse (TK) vor, dass es für Patientinnen und Patienten zukünftig eine verbindliche digitale und standardisierte Ersteinschätzung gibt, mithilfe derer sie in die geeignete Versorgungsstufe gesteuert und bei leichteren Beschwerden in das digital gestützte Selbstversorgungsmanagement überführt werden – unter Nutzung KI-gestützter Werkzeuge.
Alle Reformen und Transformationen müssen am Ende zum Erhalt einer guten Patientinnen- und Patientenversorgung führen. Dabei gilt es zunächst, Erprobtes und Bewährtes zu verbessern und weiterzudenken, bevor neue Versorgungsformen entwickelt und erprobt werden – natürlich unter Anwendung digitaler Lösungen, die zeitlichen und bürokratischen Aufwand reduzieren und rascheres Handeln ermöglichen. Bestimmend muss der Versorgungsbedarf unserer Patientinnen und Patienten bleiben und damit die Notwendigkeit, die Mittel für die Erbringung der jeweiligen Leistungen zur Verfügung zu stellen.
Gleichsam befindet sich die ärztliche Selbstverwaltung in der digitalen Transformation. Es zeigen sich Chancen, Herausforderungen und Grenzen und wir eruieren dabei die Möglichkeiten, wie die Digitalisierung die ärztliche Selbstverwaltungskörperschaft insbesondere in den Bereichen Weiterbildung, Fortbildung oder Berufsordnung optimieren kann. Weg vom Papier und analogen Formaten hin zu Apps und digitalen Anwendungen, die auf allen Endgeräten funktionieren – ob Rechner, Laptop oder Smartphone.
Was tut hier die BLÄK für Ärztinnen und Ärzte? – Sie:
» digitalisiert die internen Arbeitsprozesse (wo notwendig) und schafft neue Kommunikationsplattformen,
» investiert kontinuierlich in die Verbesserung ihrer Verwaltungs-abläufe und beschleunigt ihre internen Prozesse,
» erhöht die Transparenz über den Bearbeitungsstand und entwickelt die Organisationskultur weiter.
Um die Modernisierung der BLÄK zu ermöglichen und, einfach gesagt, schneller, effizienter, digitaler und transparenter in der Antragsbearbeitung, zu werden, wurde – zum ersten Mal seit 2014 – eine Anpassung der Kammerbeiträge von 0,38 Prozent auf 0,46 Prozent beschlossen. Erstmals werden auch die Ärztinnen und Ärzte im Ruhestand veranlagt. Insbesondere Letzteres ist bei anderen Landesärztekammern bereits gelebte Realität, und unterstreicht noch einmal den Solidaritätsgedanken und die Generationengerechtigkeit. Unsere Entscheidung zur prozentualen Beitragserhebung resultiert daraus, dass bei einer pauschalen Veranlagung für unterschiedlich hohe Alterseinkünfte gleiche Beiträge entrichtet werden müssten, was unserem Sinn für Gerechtigkeit widersprochen hätte.
Der Begriff Generationengerechtigkeit, auch Enkelgerechtigkeit oder intergenerative Gerechtigkeit, bewertet dabei die Gerechtigkeit von Handlungen und Entscheidungen, die sich auf kommende Generationen auswirken. Der Ökonom Richard Hauser formuliert: „Jede Generation sollte an die nachfolgende einen positiven Nettotransfer leisten, der höher ist als jener, den sie von ihrer Vorgängergeneration empfangen hat.“ [1] Darunter fallen unter anderem Investitionen in Bildung und Infrastruktur. Als letztere kann man durchaus auch unsere Körperschaft begreifen.
Das heißt, dass auch meine Generation Verantwortung für die nachkommenden Kolleginnen und Kollegen übernimmt in Hinblick auf den Erhalt einer eigenständigen Ärztinnen- und Ärztevertretung, die es immer zu verteidigen gilt, selbst dann, wenn man sie so gut wie nicht mehr in Anspruch nimmt. In diesem Sinn darf ich mich bei allen Ärztinnen und Ärzten im Ruhestand bedanken, die diesen Beschluss zur Zukunftssicherung der BLÄK mittragen.
So kann die Transformation der Kammer gelingen, die nicht um ihrer selbst willen, sondern aus der Notwendigkeit des Umbaus heraus erfolgt und die Bedürfnisse ihrer Mitglieder in den Mittelpunkt stellt. Wir alle sind Kammer.
Teilen:
Das könnte Sie auch interessieren: